
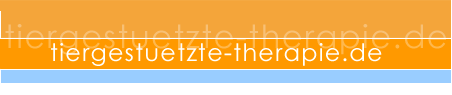
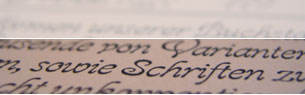

|
|
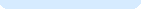 |
| tt-Texte | wissenschaftliche Texte | |
Fallbeispiel: Seit Juni 1997 lebt die 7-jährigeSandra in einer Pflegefamilie; seit Juli 1997 befindet sie sich in Therapie. Das Mädchen leidet unter einer angeborenen Stoffwechselerkrankung und ist sowohl körperlich als auch geistig in der Entwicklung verzögert. Was "Spielen" bedeutet, erfaßt Sandra nicht; angemessene Interaktion mit Spielkameraden ist ihr fremd. Weder kann Sandra eigene Gefühle kognitiv einordnen, noch die Gefühle anderer erfassen (mangelnde Empathiefähigkeit). Ziel der Therapie ist es, die Beziehungsfähigkeit des Kindes zu fördern. Sandra war bisher drei Mal in der Praxis.
1. Mal:
2. Mal:
3. Mal: Woher dieser deutlich verbalisierte Wunsch nach "Liebhaben" kommt, war an dieser Stelle unklar.
Erkennbar wurde, daß Sandra 1. die Ursache von ablehnendem Verhalten durch die Umwelt nicht klar war, 2. Ablehnung mit "Nicht-Liebhaben" gleichsetzte, 3. am Kätzchen eher als durch geschwisterliches Verhalten lernen konnte, daß grobes Verhalten Ablehnung hervorruft.
An dieser Stelle sei jedoch nicht verschwiegen, daß die mir so erfolgreich scheinende Therapie ein unvorhergesehenes Nachspiel hatte: Wie soeben dargelegt, kann die Einbeziehung von Tieren in das therapeutische Setting unvorhergesehene Konsequenzen nachsichziehen. Mit diesem Beispiel soll die Vielschichtigkeit des Themas nur kurz angerissen werden. Zahlreiche Aspekte gäbe es noch zu beleuchten, u.a. bezüglich der entstehenden sehr komplexen Beziehungsdynamik zwischen Tier(en), Klient(en), Angehörigen (Eltern) und Therapeut(in) - aufgrund zuweilen emotional dichter Interaktion. Ebenso darf nicht vergessen werden, daß auch die Tiere empfänglich für Atmosphäre und Spannungen sind und ihrerseits - bisweilen für uns unberechenbar erscheinend - auf menschliche Interaktionspartner gefühlsmäßig differenziert reagieren und ihrerseits in der Lage sind, tiefgreifenden Einfluß auf die Beziehungsdynamik zu nehmen. Für Therapeuten ist die Einbeziehung von Tieren in die Therapie auf jeden Fall mit erhöhtem Energieaufwand verbunden, zumal außer psychodynamischen Prozessen auch Gefahren für die Tiere ebenso wie von den Tieren ausgehende Gefahren "im Auge" (im wahrsten Sinn des Wortes!) behalten werden sollten. Wenn wir mögliche Komplikationen bedenken, den erhöhten Energieaufwand nicht außer Acht lassen und uns jetzt nach diesem Einleitungsbeispiel fragen: "Was bringen Tiere in der Therapie?", ist die Frage selbst schon falsch gestellt. Die Frage nach dem Nutzen von Tieren wäre eine gänzlich untherapeutische Frage. Das Tier würde zum Objekt der Therapie gemacht werden, zum reinen Medium, um therapeutische Zwecke mehr oder weniger gut erfüllen zu müssen. Jetzt werden Sie einwenden, wie ich dazu käme, etwas als "untherapeutisch" abzuwerten. Meine Lebensphilosophie verbietet es mir, Lebewesen zum Objekt zu machen (s. Buber). Tiere stellen eine qualitative Bereicherung der psychotherapeutischen Praxis dar. Sie erweitern die Kontaktmöglichkeiten der Klienten und erhöhen deren Beziehungsfähigkeit. Therapeutische Grundannahme ist hierbei, daß das Klientel in der Hauptsache unter erheblichen Beziehungsproblemen leidet, teilweise mitbedingt durch kognitive Einschränkung und mangelhafte Wahrnehmungsverarbeitung. Da die Verursachung der Beziehungsproblematik höchst vielfältig ist, ist ein therapeutisches Vorgehen angebracht, das möglichst ganzheitlich (integrativ) wirkt, indem es den Menschen auf vielen Spürebenen berührt. Der integrative Gedanke wird in hiesiger Praxis außerordentlich weitgehend verfolgt. Es handelt sich um eine Praxis am Rande einer Kleinstadt. Die Therapie findet variabel in den Wohn- oder Praxisräumen oder draußen in der Natur (Wald, Wiesen, Höhlen) statt.
In die Therapie sind auf selbstverständliche Art und Weise sowohl meine vier Kinder als auch die momentan mit uns lebenden Tiere miteingebunden: Fische in zwei großen Aquarien, drei Katzen, ein Hund (Berner Sennenhund), vier Pferde (Shetlandpony-Wallach, Islandpony-Stute, Friesen-Andalusier-Wallach, Lippizaner-Mix-Stute). Die Klienten sollen hier nicht das Gefühl haben, "therapiert" zu werden, sondern die Möglichkeit erhalten, ihre soziale Kompetenz "wie von selbst", also auf nahezu "selbstverständliche" Art und Weise zu erweitern (s. P. Hofstätter). Welches therapeutisches Konzept hat sich in hiesiger Praxis unter Einbeziehung von Tieren nun bewährt? (Das obige Fallbeispiel ist hier nicht repräsentativ, sondern sollte nur in die Problematik einführen!).
Zunächst wird davon ausgegangen, daß eine gewisse Hierarchie der Beziehungsmöglichkeiten zu Tieren besteht: Es gibt Tiere, die man nur anschauen kann (Fische), die man berühren kann, aber wenig Reaktion zeigen (Schildkröten), die ihr Mißfallen oder Behagen deutlich anzeigen (Katzen, Hunde) und solche, die ihre Gefühle deutlich machen und auf denen man sogar sitzen und die Gefühle körperlich spüren kann (Pferde). Die körperliche Spürebene ist in unseren Breiten bei keinem anderen Tier in dieser Weise gegeben, weshalb diese Tiere an die Spitze der Hierarchie gestellt wurden. Grundsätzlich gilt, daß es sich um beziehungsfähige, Menschen zugewandte Tiere handeln muß, die dem Therapeuten vertraut sind.
Folgendes Modell bezüglich Tieren in der Praxis wurde nach langjähriger gemeinsamer Erfahrung von meiner Kollegin und Freundin Frau Dipl.-Psych. Holzer-Thieser und mir entwickelt (spontane Änderungen des Therapie-Konzeptes inbegriffen):
5 - Phasen - Modell
Phase I: Anwärmphase / Diagnostik
Phase II: Verlaufsdiagnostik (Praxis / Wohnbereich) Selbstverständliche Einbeziehung meiner Familie Kontaktaufnahme mit weiteren Bezugspersonen des Kindes Besuch in Elternhaus / Kindergarten / Schule In der Regel zunehmendes Interesse an den Tieren
Phase III: Klienten entwickeln Erwartungen bezüglich
Phase IV: Erweiterung des therapeutischen - sowohl räumlich (Gang in die Natur) als auch bezüglich der Kontaktmöglichkeiten (meine Kinder dürfen auf Wunsch mitspielen; in die Therapie)
Phase V: Abschluß-Phase Geschwister oder Freunde dürfen hin und wieder mitgebracht werden
Worin liegt nun der Unterschied zur Ergotherapie oder anderen therapeutischen Verfahren? Wir können uns der Verbesserung der Beziehungsfähigkeit von außen oder von innen nähern: beides ergänzt sich. Die Ergotherapie kann durch Schulung körperbezogener Bereiche (Sensorik/Motorik) das Spüren des eigenen Körpers verbessern helfen, wirkt also eher von außen im Sinn eines Übungscharakters auf die Beziehungsfähigkeit ein. Die Psychotherapie wirkt eher von innen nach außen: Was erlaubt das Tier an Kontakt? Im Vordergrund stehen dabei Gefühle. Je höher die Intensität der Gefühle, um so heilsamer verläuft der therapeutische Prozeß (s. F. Perls). In der Psychotherapie besteht die Möglichkeit, sich einzeln oder in kleinen Gruppen dem Klienten zuzuwenden. Es ist eine Kostenfrage, welche Klienten von einer solchen Therapie profitieren dürfen. In der Regel bleibt sie wenigen, stärker beeinträchtigten Menschen vorbehalten - außer sie sind nicht auf die Finanzierung durch die Krankenkasse angewiesen.
Kinder, die sich in der ergotherapeutischen Praxis als relativ stark im Sozialverhalten beeinträchtigt herausstellen, können in der psychotherapeutischen Praxis zusätzliche Unterstützung erfahren. Je besser zusammengerabeitet werden kann, um so integrativer die Therapie und um so erfolgreicher der Verlauf! Was spricht gegen Tiere in der psychotherapeutischen Praxis? Was sind Ausschlußgründe?
Diese sind schnell aufgezählt: 1. von Klienten Seite
2. vom Tier aus betrachtet
3. von Therapeutenseite
Zum Abschluß sei nochmals auf das eingangs erwähnte Fallbeispiel eingegangen: Zum einen kann es in diesem Fall als therapeutisch ungünstig betrachtet werden, Tiere so früh in die Therapie einzuführen - wenn auch nur hinsichtlich der Beziehung zur Mutter, nicht bezüglich des Therapie-Fortschritts beim Kind. Zum anderen haben die Bedenken der Mutter mich so überrascht, daß sie nicht mehr insoweit entkräftet werden konnten, als daß ein vorübergehender Therapie-Abbruch hätte vermieden werden können. Nach erneuter Therapie-Aufnahme vor kurzem ergab ein ausführliches Gespräch mit der Mutter mittlerweile Akzeptanz bezüglich der gebotenen Therapie und die Informatine, daß es der Mutter aus gänzlich anderen als von mir zunächst vermuteten Gründen nicht möglich war, das Kind zu bringen.
Entscheidend dürfte bei Sandra sein, daß der nicht-angemessene (inadäquate) Umgang mit Tieren durch die kognitive Einschränkung mitbedingt ist. Therapeutisches Anliegen ist es demgemäß, zum einen dem Kind Signale des Tieres verstehbar zu machen, sodaß es das Kratzen des Kätzchens als "Nein" erlebt für weiteres Festhalten und nicht als persönliche Abweisung ("hat mich nicht lieb"), zum anderen, daß kleinere Vor-Signale (Kätzchen zappelt unruhig auf dem Arm) richtig gedeutet werden können, damit das Kätzchen erst gar nicht kratzen muß. Eine Generalisierung auf andere soziale Situationen (Spiel mit Geschwistern/Schule) würde beim Umgang mit Tieren therapeutisch erhofft werden.
Am Beispiel Sandra wird deutlich, wie ein Grundlagen-Aspekt von Beziehungsanbahnung (Wahrnehmung und adäquates Interpretieren von Signalen möglicher Interaktionspartner) bezüglich des Kätzchens herausgegriffen werden kann und die Erhöhung kognitiver Differenzierungsfähigkeit letzlich zu einer qualitativen Bereicherung ihrer Beziehungsmöglichkeiten führt (Familie/Schule als Interaktionsfeld). Anderen Therapeuten mag das zitierte Fallbeispiel hilfreich sein. Das Thema "Tiere in der Therapie" muß demnach dringlich vorher mit den Eltern ausführlich besprochen werden, um eine Akzeptanz für diese spezielle Form der Therapie zu gewährleisten. Sofern die entstehende komplexe Beziehungsdynamik im Blickfeld des Therapeuten bleibt, ermöglichen Tiere eine qualitative Bereicherung der psychotherapeutischen Praxis.
|
|
