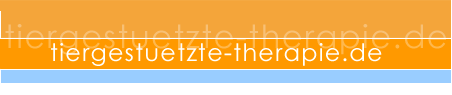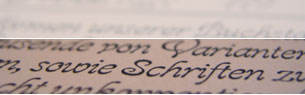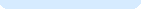Märztage
von Ursula Hentzen-Wregar
Referat zum Thema "Tiergestützte Therapie"
anläßlich des zehnjährigen Bestehens des Vereins "Tiere helfen Menschen, e.V." in Würzburg, 1997
Es war der 6. März 1990. Meine drei Kinder waren in der Schule und im Kindergarten. Ich ging in unser Schlafzimmer, um die Betten zu machen. Doch ich hielt inne, stand still im Raum und spürte wieder diese Traurigkeit.
Ich stand da mit einem Gefühl, als käme so etwas wie ein schwarzes Loch auf mich zu. Statt meine Arbeit zu erledigen, setzte ich mich auf den Bettrand. Wie schon öfter in der letzten Zeit dachte ich auch jetzt wieder, daß ich so nicht weiterleben konnte. Wieso nur war ich so unzufrieden?
Wir hatten drei liebe Kinder, es war uns gelungen, ein Haus zu bauen. Mein Mann hatte eine gute Arbeit. Es ging uns gut. Meine Gedanken schweiften durch die Landschaft meines Lebens.
Ich verließ unser Haus nur, um dringende Besorgungen zu machen oder die Kinder zu begleiten. Es fiel mir nicht leicht, draußen zurechtzukommen. Ich war sehbehindert.
Mein Sehrest betrug noch ca. 5%. Ein Auto z.B. konnte ich wohl als Farbklecks wahrnehmen, doch ob es fuhr, konnte ich nur aufgrund von Motorgeräuschen feststellen. Geschwindigkeit und Entfernung waren Erfahrungswerte. Manche Gegenstände erkannte ich nur durch Form und/oder Farbe. Ich empfand meine Wege anstrengend und fühlte mich sehr unsicher.
Doch da war noch etwas Anderes. Hörte ich die Nachbarn im Garten, traute ich mich nicht in den unsrigen. Manchmal war es so schlimm, daß ich erst den Mülleimer ausleerte, wenn ich draußen wirklich keinen Menschen mehr wahrnehmen konnte. Freunde und Bekannte hatte ich nicht.
Das war weiter nicht schlimm. Mit den Kindern hatte ich alle Hände voll zu tun, und so fühlte ich mich auch nicht allein. Verbissen versuchte ich, trotz meiner Behinderung Haus und Garten in Ordnung zu halten.
Putzen wurde eine Art Leidenschaft, und ich hatte soviel Ehrgeiz, unseren Garten so schön zu pflegen wie die Nachbarn. Und doch fühlte ich mich immer öfter wie eine Gefangene in unserem Haus oder als fiele mir die Decke auf den Kopf. Und immer diese unbestimmte Sehnsucht....
Mich ärgerte es sehr, daß mein Mann meine Bemühungen ignorierte. Nie hörte ich eine lobende Anerkennung. Manchmal, wenn ich eine Arbeit nicht geschafft oder über dem Spiel mit den Kindern vergessen hatte, kritisierte er mich. Das schmerzte mich sehr.
Und so nahm ich mir vor, mich noch mehr anzustrengen. Ich wünschte mir nichts sehnlicher von meinem Mann, als ein Lob, ein paar freundliche Worte.
Manchmal war er abends so müde, daß er nicht einmal zu einem Informationsaustausch bereit war. Ich versuchte dann immer, ihn weiter zu entlasten.
Ich teilte mich ihm nicht mehr mit. Auch wenn es um die Kinder ging, schwieg ich, traf zunehmend alle Entscheidungen allein.
Immer mal wieder dachte ich daran, wieder arbeiten zu gehen. Mein Traum war es, Geld zu verdienen, um mir davon eine Haushaltshilfe zu leisten.
Alle Menschen, die arbeiten, bekommen ihre Anerkennung, sind was wert, dachte ich. Das wünschte ich mir auch. Doch in meinem Beruf als staatlich geprüfte Hauswirtschaftlerin konnte ich nicht mehr arbeiten, denn mein Sehrest war in den letzten Jahre um ein Drittel kleiner geworden.
Ich brauchte inzwischen für alle im Haushalt anfallenden Arbeiten zuviel Zeit. Da wäre wohl eine Umschulung vonnöten.
Immer mal wieder dachte ich auch über das Zusammenleben mit meinem Mann nach. Ich war gerade 16, als ich ihn kennenlernte. Vier Jahre später heirateten wir. Ich ging mit so vielen Hoffnungen und Wünschen in diese Ehe, und ich wollte alles tun, damit wir glücklich zusammenleben konnten.
Von meinen Träumen war nichts geblieben. Ich fühlte mich, als ginge er mir verloren, und mir fiel nicht ein, wie ich ihm wieder nahe kommen konnte.
Als meine Gedanken an dieser Stelle angekommen waren, hätte ich am liebsten alles liegen- und stehenlassen und wäre davongelaufen. Doch da waren die Kinder.
Die brauchten mich noch. Ich stand auf, schüttelte die Betten auf und ging danach entschlossen ans Telefon. Ich rief beim Arbeitsamt an und ließ mir einen Beratungstermin geben.
Es dauerte einige Zeit, bis ich als Rehabilitationsfall anerkannt wurde und einen Umschulungsplatz in einem Berufsförderungswerk bei Würzburg bekam.
Am 16. März 1991 reiste ich zur Umschulung an. Ich erinnere mich noch genau an die grosse Hoffnung, an die vielen Zweifel während der Zeit davor und der Zugfahrt.
Doch als ich in einem großen Raum auf meine offizielle Aufnahme und Anmeldung wartete, wußte ich wieder ganz genau, daß ich das Richtige getan hatte.
Mit viel Energie begann ich meine Grundrehabilitation. Bevor ich einen anderen Beruf lernen konnte, mußte ich zunächst blindentechnische Fertig- und Fähigkeiten erlernen.
Dazu gehörten Mobilitätstraining und die Brailleschrift. Aber auch das Erlernen lebenspraktischer Fertigkeiten wie Nähen, Wäschepflege und Kochen.
Im Unterricht kam ich gut voran. Probleme hatte ich wieder im sozialen Bereich. Ich verkroch mich abends in meinem Zimmer, traute mich nicht, zu den anderen Kursteilnehmern Kontakt aufzunehmen. Ich empfand sie als Bedrohung.
Und wieder war da diese unbestimmte Sehnsucht.... Die Wochenenden verbrachte ich zu Hause mit den üblichen Hausarbeiten und den Kindern. Sonntags fuhr ich am Abend wieder ins Berufsförderungswerk.
Nach knapp zwei Monaten bekam ich gesundheitliche Probleme. Mit großer Anstrengung schaffte ich noch die Grundrehabilitation. An der anschließenden Berufsrehabilitation konnte ich nur noch drei Monate teilnehmen. Meine Umschulung wurde abgebrochen.
Beim Arbeitsamt sagte man mir, daß ich nach meiner Genesung wieder ins Berufsförderungswerk zurückkehren und meine Ausbildung fortsetzen könnte.
Es war bereits der 15. Juni 1993, als ich zum zweiten Mal mit viel Hoffnung aufbrach. Mir ging es wieder besser, und ich wollte auf jeden Fall einen guten Abschluß erreichen.
Doch nach zwei Wochen im Berufsförderungswerk ging es mir wieder so schlecht, daß ich die Umschulung nun endgültig abbrechen mußte. Man empfahl mir, Rente zu beantragen.
Nun sollte ich für den Rest meines Lebens in unserem Haus verbringen, putzen, waschen und auf meinen Mann warten - zunehmend auch auf die Kinder.
Ich war damals 36 Jahre alt. Möglichkeiten, mein Leben zu verändern und zu gestalten, sah ich nicht mehr. Den Rentenantrag stellte ich, sah ihn als Schlußpunkt, denn ich wollte ja arbeiten und mit dem Einkommen auch Anerkennung und Dazugehörigkeit erlangen.
Ich bedachte, wie allein ich zukünftig wäre und fürchtete mich mehr denn je vor meiner Zukunft.
Mir wurde klar, daß ich ganz dringend einen Hund brauchte, denn ich wußte, daß ich sonst bestimmt nur höchst selten das Haus verließe.
Doch wie sollte ich auf einen Hund aufpassen und ihn erziehen? Inzwischen war ich erblindet.
So kam ich auf die Idee, mich zu erkundigen, was ich unternehmen müsse, um einen Blindenführhund zu bekommen. Ich erfuhr, daß das Genehmigungsverfahren recht einfach war. Es dauerte nicht einmal ein Monat, da war der Führhund genehmigt und bestellt.
Soweit konnte ich zufrieden sein. Doch machte mir meine Gesundheit wieder große Probleme. Diesmal kam ich nicht umhin, einen länger dauernden Klinikaufenthalt durchzustehen. Anfang Februar 1994 begann meine statiönäre Behandlung. Ich mußte erkennen, daß meine gesundheitlichen Probleme psychische Ursachen hatten, daß mein Furcht vor den Menschen nichts Anderes als eine schwere Kontaktstörung war, und ich nicht allein sondern sehr einsam war.
Die Ursache für all das waren Traumata, die ich in frühester Kindheit bis hin zur Pubertät erlitten hatte. Teilweise hatte ich sie sehr gut verdrängt. Durch die Therapie konnte ich die Erinnerungen Stück für Stück wieder zulassen.
Es fiel mir schwer, sie als Teil meiner Biographie hinzunehmen. Über Monate hinweg fand ich langsam den Weg zurück zu den Menschen. Ich machte die Erfahrung, daß ich liebenswert bin, auch wenn ich aufgrund meiner Behinderung nicht so leistungsfähig sein kann.
Ich lernte langsam, den Menschen wieder zu vertrauen, daß nicht alle mir Böses wollen. Ich übte innerhalb des therapeutischen Rahmens, Kontakte zu knüpfen und zu halten. Letzteres fiel mir besonders schwer, wenn ich den Eindruck hatte, daß die anderen mich nicht mögen oder Meinungsverschiedenheiten zu klären waren.
Nach sechs Monaten stationärer Therapie ging es mir erstmals seit Jahren wieder richtig gut. Ich freute mich auf zu Hause, auf die Kinder und meinen Mann.
Ich hatte auch wieder Perspektiven und Ideen, wie ich mein Leben nun gestalten konnte.
Im November 1994 war es endlich soweit: Ich bekam meinen Führhund. Ich fuhr zur Einschulung in den Bayerischen Wald. Der schwarze Labrador "Blacky" und ich wurden miteinander bekannt gemacht. Ich glaube, es war Liebe auf den ersten Blick. Bereits nach einer Woche waren wir unzertrennlich.
Ich meine, das ist schon etwas Besonderes, denn Blackys Ausbildung dauerte doch fast 18 Monate, und er hing zunächst sehr an seinem Ausbilder. Anfang Dezember 1994 holte mein Mann Blacky und mich aus der Führhundschule ab.
Nachdem der Klinikaufenthalt mein Leben schon grundlegend verändert hatte, besorgte mein lieber Hund nun das Übrige. Mit seinem Einzug bei uns veränderte sich schlagartig der Tagesablauf im Haus.
Ich verwandte immer noch viel Zeit für die Haushaltspflege. Doch nun mußte ich mindestens drei Stunden davon für die Spaziergänge mit Blacky abzweigen. Entsetzt war ich über die Mengen von Schmutz, die er ins Haus trägt.
Zunächst versuchte ich noch, dagegen anzuputzen, doch das gab ich bald auf. Seither knirscht auf unserem Parkett der Sand unter den Schritten. Die Hundehaare sind inzwischen ein fester Bestandteil der Wäsche, Teppiche und mancher Dinge, wo man sie wirklich nicht vermutet.
Das fiel mir unglaublich schwer, weil ich im Kopf immer noch das Bild eines gepflegten Haushaltes hatte.
Es dauerte nicht lange, bis ich von einer anderen Hundehalterin angesprochen wurde, ob wir nicht zusammen mit den Hunden spazierengehen wollten.
Sie erzählte mir, daß sich morgens mehrere Frauen - alle mit Hunden - treffen und zusammen gehen. Ich schloß mich ihnen an. Durch die Hunde war es nicht schwer, Kontakt zu bekommen. Gesprächsthemen gab es immer.
Es war für mich ein besonderer Vorgang: Nach neun Jahren - so lange wohnten wir hier schon - war ich endlich eingebunden und fühlte mich zunehmend daheim.
Blacky und ich sind inzwischen mehr als drei Jahre zusammen. Mein Leben hat sich durch ihn sehr verändert. Während ich in der Zeit ohne ihn mehr auf die Begleitung durch andere Menschen angewiesen war, bin ich jetzt bemerkenswert unabhängig und mobil.
Ich bin auch unabhängig von Zeitvorgaben und muß meine Interessen nicht mit Begleitpersonen abstimmen. So konnte ich ausprobieren und meinen Alltag neu gestalten.
Die gravierendste Veränderung in meinem Leben war die Trennung von meinem Mann. Mein Hund gab mir soviel Freiheit und soviel Mut, diesen Schritt zu tun.
Ich bin dankbar, für die Zeit, die ich mit ihm verbringen durfte, für die Chancen, die wir durch unsere Ehe bekamen.
Ich empfinde es beinahe als Gnade, daß wir heute ein gutes Verhältnis zueinander haben und miteinander reden können. Ich freue mich über jede Begegnung mit ihm.
Schon immer mochte ich geistliche Chormusik. Durch meinen Hund lernte ich eine Frau kennen.
Diese stellte den Kontakt zu einer anderen her, die seit Jahren in einer Kantorei singt und mich mitnahm. Nun singe ich seit beinahe drei Jahren für mich wunderschöne Musik. Mit den anderen Frauen treffe ich mich morgens immer noch. Inzwischen sind wir nur noch fünf. Über die Jahre sind wir recht vertraut miteinander geworden. So gehen wir nicht mehr nur mit unseren Hunden spazieren. Manchmal gehen wir gemeinsam ins Kino oder zum Italiener.
Durch sie erfahre ich Hilfe im Krankheitsfalle, im Haushalt oder bei Besorgungen. Durch meinen Blacky lernte ich auch eine Frau kennen, die sich in unserer Stadt sozial sehr engagiert. Sie bat mich, doch einmal in eine Altentagespflegestätte mitzugehen. Sie erzählte mir, daß sie da mit den Menschen singt. Ich solle mir das doch einmal anhören, weil ich doch etwas von Musik verstünde, und ihr wenn möglich ein paar Tips geben.
Gerne ging ich mit und hörte zu. Es gefiel mir gut, und ich war überrascht, wie viele von den alten Volksliedern und Schlagern mir noch bekannt waren.
Ich dachte: da fehlt etwas. Spontan erzählte ich, daß ich noch ein altes Akkordeon im Keller hatte. Ich bot an, wieder mitzugehen und die Lieder zu begleiten. Das war der Beginn meines Engagements im Verein "Tiere helfen Menschen". Inzwischen kann ich sagen, daß der Besuchsdienst mir viel Freude bereitet. Ich besuche nicht nur die Altentagespflege, sondern ein weiteres Altenheim.
Blacky und das Akkordeon sind immer dabei, manchmal auch meine Gitarre oder Flöte.
Durch den Hund ergeben sich immer kleine Gespräche am Rande, und die Musik verbindet sowieso. Manchmal, wenn die Leute meinen Hund streicheln, dann erzählen sie von früher, vom eigenen Hund. Bei manchen löst sich durch die Berührung mit dem weichen Fell auch etwas, und dann weinen sie endlich lange zurückgehaltene Tränen.
Es ergeben sich Augenblicke sehr großer Nähe. Mich rührt das immer sehr und auch ich genieße diese Wärme.
Es ist wieder März. Inzwischen habe ich einen Lebensgefährten gefunden. Und abends sitze ich jetzt oft auf dem Bettrand und höre Blackys gleichmässigen Atemzügen zu.
Das gibt mir soviel Sicherheit und Zuversicht.
Und wenn mein noch junges Vertrauen zu den Menschen wieder einmal in seinen Grundfesten erschüttert ist, dann führt er mich durch die Nacht ins Licht.
Daß der Hund Dir das Liebste sei,
sagst Du, oh Mensch, sei Sünde.
Der Hund blieb Dir im Sturme treu,
der Mensch nicht mal im Winde
|